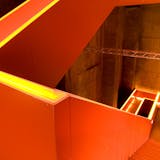Erhalt durch Umnutzung
Gespräch mit Prof. Dr. Hans-Peter Noll und Architekt Heinrich Böll
Ein Zukunftsstandort im Fokus
Herr Böll, Sie waren maßgeblich an der Realisierung des Masterplans Zollverein beteiligt. Welches Fazit ziehen Sie heute?
Heinrich Böll: Zunächst einmal bin ich mit dem Ergebnis insgesamt zufrieden. Die Zusammenarbeit mit anderen Architekten, zum Beispiel dem Büro O.M.A. von Rem Koolhaas, war fantastisch. Wir haben hier vor Ort gemeinsam viel bewegt. Die Kohlenwäsche als eines der Hauptprojekte war rückblickend ein langer, aber konstruktiver Kampf mit der Denkmalpflege. Für mich ist dieses Gebäude beispielgebend für den gesamten Prozess der Umnutzung. Wir haben das Gebäude, das ja eigentlich eine umhüllte Maschine ist, hunderte Male begangen, betrachtet und untersucht. Dabei galt es, Räume zu erschließen, die zuvor nicht zugänglich waren – etwa die Kohlenbunker, die teils zu Treppenhäusern umfunktioniert worden sind. Wir haben unsere Aufgabe so verstanden, das Gebäude für Zollverein-Besucher nicht nur umzubauen, sondern erlebbar zu machen.
Herr Prof. Noll, wie bewerten Sie die Umsetzung des Masterplans auf Zollverein?
Prof. Hans-Peter Noll: Zunächst einmal möchte ich Heinrich Böll für sein Engagement hier auf Zollverein danksagen. Nach dem Architekten-Duo Fritz Schupp und Martin Kremmer, die Zollverein um 1930 gestaltet haben, wirkten Heinrich Böll und sein Büropartner Hans Krabel maßgeblich daran mit, Zollverein als Architekturdenkmal baulich zu erhalten.Das ist eine stolze Leistung!
Jetzt zu Ihrer Frage: Die Kriterien für die Auszeichnung des UNESCO-Welterbes Zollverein sind Authentizität, also Echtheit, und Integrität, also Unversehrtheit. Dem Büro Böll ist es bei allen Umbauprojekten auf Zollverein sehr gut gelungen, diese beiden Kriterien zu bewahren. Und auch bei künftigen Um- und Neunutzungen ist esunsere Verpflichtung, sie zu erhalten.
Herr Böll, sind Erhalt und Entwicklung nicht ein Widerspruch?
Heinrich Böll: Nein, Erhalt und Entwicklung sind kein Widerspruch. Wir haben 1989 vor jetzt 30 Jahren angefangen, zunächst einmal die Fassaden und Dächer in Ordnung zu bringen. Am Anfang gab es ja kein Konzept. Das Einmalige an Zollverein ist die Reduktion auf nur vier Materialien, nämlich Beton, Ziegel, Stahl und Drahtglas – von dem kleinen Pförtnerhäuschen bis hin zur Kohlenwäsche, das gesamte Ensemble.Diese gilt es zu erhalten. Dazu eine kleine Anekdote: Bei einer Begehung vor Jahren fragte mich ein Besucher: Was haben Sie hier eigentlich gemacht? Sieht doch aus wie früher. Zunächst habe ich mich sehr geärgert, dass man nicht sieht, was wir hier an Arbeit hineingesteckt haben. Erst später habe ich das Kompliment dahinter verstanden. Die Leistung besteht darin, keine Spuren hinterlassen zu haben und in der Tradition der Ursprungsarchitektur von Schupp und Kremmer geblieben zu sein. Und genau deshalb hat sich Zollverein zu dem entwickelt, was es heute ist: Als fantastisches Denkmal ist Zollverein zu einem Besuchermagneten geworden und gleichzeitig Bildungs- Campus, Kultur- und Wirtschaftsstandort.
Im Mittelpunkt weiterer Planungen muss laut UNESCO der Erhalt des außergewöhnlichen universellen Wertes des Welterbes stehen. Inwieweit schränkt diese Verpflichtung, insbesondere bei Neubauvorhaben, ein, Herr Böll?
Heinrich Böll: Wenn wir das so gemacht hätten, wie der Denkmalsschutz es sich zunächst vorgestellt hat, wäre Zollverein heute ein toter Ort. Dauerhaft war es ein gemeinsames Ringen um die besten Lösungen. Schlussendlich war es sogar möglich, andere als die vier genannten Materialien zu verwenden, um Neubauten von den Ursprungsgebäuden für den Betrachter abzugrenzen. Dennoch: Die Architektur von Schupp und Kremmer stand für uns immer im Vordergrund. Die UNESCO hat bei der Begehung vor der Auszeichnung nur zwei Dinge ernsthaft kritisiert: Das Sonnenrad auf der Kokerei und den ursprünglich von dem Büro Diener & Diener geplanten Kubus auf der Kohlenwäsche, der dann nicht realisiert wurde, weil er die Gestalt des Gebäudes zu sehr verändert hätte.
Herr Prof. Noll, der satzungsgemäße Auftrag der Stiftung Zollverein sind die Erhaltung, der Betrieb und die Weiterentwicklung des Standortes als UNESCO-Welterbe. Welche Herausforderungen und welche Chancen verbergen sich dahinter?
Prof. Hans-Peter Noll: Beim Betrieb und bei der Unterhaltung dieses Standortes müssen täglich viele Fragestellungen gelöst werden. Insbesondere bei Erstinstandsetzungen waren in den vergangenen Jahren innovative Lösungen die besondere Herausforderung. Das ist oft sehr gut gelungen und sicher auch beispielgebend für andere Standorte. Für die künftige Weiterentwicklung des Denkmals Zollverein brauchen wir eine übergeordnete Strategie, die wir jetzt fortschreiben wollen. Wir sind seitens der UNESCO verpflichtet, alle fünf Jahre einen Managementplan vorzulegen. Der neue Plan für Zollverein wird Ende 2019 fertiggestellt sein und uns sozusagen Leitplanken für die künftige Entwicklung des Standortes geben. Auf unserer Agenda steht der Erhalt des Welterbes Zollverein weiterhin im Mittelpunkt. Und von hier aus blicken wir in die Zukunft.
Das Gespräch führte Guido Schweiß-Gerwin.